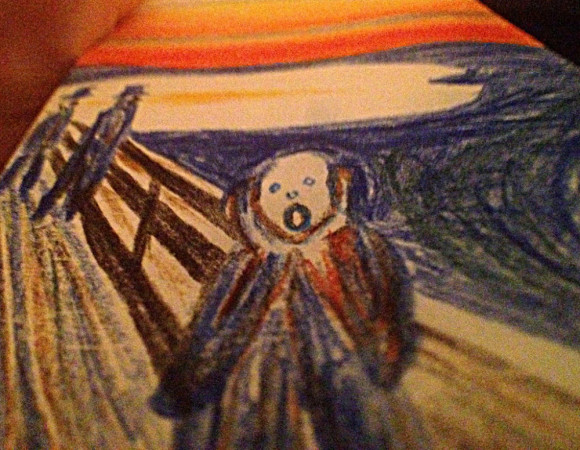Eine Fassung von Edvard Munchs “Schrei” hängt gerade im Van-Gogh-Museum in Amsterdam und damit nur vier Zugstunden von mir entfernt. Die Sonderschau “Munch – Van Gogh” bringt zwei Verzweifelte zusammen, die zwar aus einer Generation stammen und sich in Paris in denselben Kreisen bewegen, sich jedoch nie persönlich begegnen. Hier Vincent van Gogh, der Sonnenblumen, Hauswände, sogar sein Bett in ein lebensbejahendes Gelb taucht, und der dann kurz vor seinem Freitod mit 37 Jahren diesen unheimlichen schwarz-blauen Himmel voller Raben über das sattgelbe, von ins Nichts führenden Wegen durchzogene Weizenfeld spannt. Dort Edvard Munch, der Hypochonder, dem der Tod früh die engsten Angehörigen wegreißt. Wieder und wieder malt er das Abschiednehmen, das Sterben, malt Menschen, die von tiefer Traurigkeit gebeugt sind, und Gesichter wie Totenmasken. Über 80-jährig schläft er am Ende friedlich und bereits zu Lebzeiten berühmt in seinem Bett ein. Man bekommt sie schwerlich unter einen Hut, diese beiden Maler. Vielleicht so: Beide vermochten es auf ihre ganz eigene Weise, Gefühle so auf die Leinwand zu bringen, dass sie Betrachtern bis heute unter die Haut gehen.
In Munchs Worten:
[su_quote cite=”Edvard Munch, 1933″]„In seiner kurzen Karriere ließ Van Gogh seine Flamme nicht erlöschen. In seinem Pinsel waren Feuer und Glut in den wenigen Jahren, in denen er für seine Kunst brannte. – Ich habe in meiner Laufbahn, die länger war und bei der ich mehr Geld zur Verfügung hatte, gedacht und gewollt, dass wie bei ihm meine Flamme nicht erlischt und ich bis zuletzt mit einem brennenden Pinsel malen kann.“
[/su_quote]
In Vincent van Goghs Weizenfeld mit Raben brennt der Pinsel zweifellos. Es ist nicht Teil der Sonderausstellung, hat aber seinen dauerhaften Platz nebenan im Haupttrakt des Van-Gogh-Museums – hängt also nicht weit.
Munchs “Schrei” zu sehen (genauer einen seiner “Schreie”, er schuf vier Gemälde und einigen Lithografien des Motivs), ohne die weite Reise nach Oslo machen zu müssen – ich kann diese Gelegenheit einfach nicht verstreichen lassen. Wie traurig aber, dass das Entsetzen, die Seelenqual, die Munch vor mehr als 100 Jahren in schmerzhaft-grellen Farben und harten Strichen festhält, so sehr zu den Ereignissen dieser Tage passt.
Ich will nicht, dass der Terror mich verändert, aber er tut es. Das merke ich auf der Fahrt im ICE, wo ich meine Mitreisenden misstrauischer betrachte als sonst. Ich merke es daran, dass mein Adrenalin in die Höhe schießt, wenn der Zug nahe der Grenze wegen “polizeilicher Ermittlungen” auf freier Strecke stehen bleibt. Ich merke es, wenn ich bei Verabredungen in anderer Weise als üblich über den Treffpunkt nachdenke. Und sogar an dem Trotz merke ich es, mit dem ich in diesem Jahr meine Weihnachtsmarkt-Besuche plane.
Nicht der Terror sollte uns verändern, sondern die Einsicht, dass fast alles, was wir tun oder lassen, irgendwann auf uns zurückfällt, im Guten wie im Schlechten. Ich glaube fest, dass offene Türen für Menschen, die vor Fundamentalismus, Krieg, Gewalt und Hunger fliehen, eine bessere Terror-Prävention sind als jede Abschottungs- und Überwachungsmaßnahme (wenn man diese Türen denn nicht schon aus Nächstenliebe öffnen mag). Jede Familie, die wir am eigenen Leib spüren lassen, dass sie in unserer Mitte frei und sicher leben kann, ist für Fundamentalisten verloren. Und ich glaube keine Sekunde, dass mehr Luftangriffe, mehr Bomben, mehr Kriegsrhetorik die Welt auch nur einen Deut sicherer machen.
Edvard Munch ist 70 Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Er lebt zurückgezogen in Norwegen in einer ehemaligen Gärtnerei in einem heutigen Stadtteil von Oslo, das damals noch Christiana hieß, und macht sich Sorgen: In Deutschland hat er viel ausgestellt, schaffte dort seinen Durchbruch, er verkauft seine Werke vornehmlich an deutsche Kunden und lagert noch immer einige seiner Bilder in Berlin. Die Nationalsozialisten sind sich indes anfangs nicht so ganz sicher, ob sie Munchs Werke ablehnen oder an sich reißen sollen (oder beides). 1933 feiert Goebbels Munch noch als “Erben nordischer Natur”, doch wenige Jahre später gilt seine Kunst dem Nazi-Regime als “entartet”.
Zu den Bildern, die von Oslo nach Amsterdam reisten und mich besonders beeindruckt haben, gehören diese:
Das kranke Kind: Munch verarbeitet in diesem Bild den Tod seiner Schwester Sophie, die rund zehn Jahre zuvor an Tuberkulose starb. Tröstlich finde ich den Gesichtsausdruck der Kranken: Sie sieht die an ihrem Lager zusammengesunkene Angehörige mit hoch erhobenem Kopf an, als habe sie die Unausweichlichkeit nicht nur akzeptiert, sondern auch die Zuversicht und den festen Glauben, in eine bessere Welt zu gehen. Die Todgeweihte tröstet die Zurückbleibende …
Nacht in Saint Cloud: Zur Entstehungszeit des Bildes verlebt Munch eine wenig glückliche Zeit in Frankreich. Von Paris aus ist er in die südlich gelegene Ortschaft Saint-Cloud gezogen. Kurz zuvor hat er erfahren, dass sein Vater gestorben ist. Seine Mutter starb bereits, als Edvard fünf Jahre alt war. Der Mann auf dem Bild sitzt am Fenster eines abgedunkelten Raumes und sieht auf die Seine hinaus. Er ist angezogen, als habe er ausgehen wollen – und es dann doch nicht geschafft, die Wohnung zu verlassen …
Rue Lafayette: Und dann, zwischen düsteren Werken, hängt dieses, das tatsächlich ein wenig an van Goghs Pinselführung erinnert. Ich habe lange davor gestanden. Wie minimalistisch die Straßen-Szenerie, auf die man gemeinsam mit dem Betrachter vom Balkon herunterschaut, mit fliehenden Strichen angedeutet ist – und wie realistisch diese flüchtige Welt trotzdem wirkt. Kutschen, Pferde, Fußgänger – man erkennt alles!
Sternennacht: Ein Motiv, das es beiden, van Gogh und Munch, angetan hat. Mir ebenfalls.
Der Schrei: Als ich in Amsterdam schließlich vor diesem Werk stehe, bin ich überrascht: Das Bild, die Kreidefassung von 1893, ist viel kleiner und unscheinbarer, als ich erwartet hatte – doch deshalb nicht weniger eindringlich.
Neben dem “Schrei” haben die Kuratoren ein Bild van Goghs platziert, das in Privatbesitz ist: Die Brücke von Trinquetaille. Auf den ersten Blick ein heiteres Motiv: Ein heller Tag, gelassene Menschen an einem Fluss… Nur das Mädchen im Vordergrund irritiert: Schützt es die Augen vor der blendenden Sonne – oder weint es?
Den Schlusspunkt der Schau bilden zwei Werke, die als “Testamente” präsentiert werden. Van Gogh und Munch erlauben einen Blick in den wohl intimsten Raum einer Wohnung, das Schlafzimmer. An den Wänden hängen Bilder, die auf das eigene Lebenswerk verweisen.
Van Gogh ist nicht zuhause. Munch hingegen stellt sich mitten hinein, er posiert ein bisschen steif wie für eine Homestory, die ihm eigentlich unangenehm ist. Er steht neben einer Uhr, die keine Zeiger hat, als wisse er, dass seine Zeit abgelaufen ist. Im Jahr nach Vollendung des Bildes stirbt er.
Handle with Care
Munchs Pastell-“Schrei” wurde übrigens in Oslo vor dem Transport nach Amsterdam mit einem Lichtsensor versehen. Die Technik misst permanent den Lux-Wert, dem das Werk ausgesetzt ist. In diesem Video erklärt das Munch-Museum, warum das wichtig ist und wie es funktioniert:
Die Sonderausstellung Munch – van Gogh ist noch bis 17. Januar 2016 in Amsterdam zu sehen. Danach reisen “Der Schrei” und all die anderen großartigen Werke wieder heim nach Norwegen und Paris – und kommen dort hoffentlich wohlbehalten an.